Leichtathletik-Europameisterschaften 1969/Weitsprung der Männer
Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 wurde am 17. und 18. September 1969 im Athener Karaiskakis-Stadion ausgetragen.
| 9. Leichtathletik-Europameisterschaften | |
|---|---|
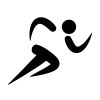 | |
| Disziplin | Weitsprung der Männer |
| Stadt | |
| Stadion | Karaiskakis-Stadion |
| Teilnehmer | 25 Athleten aus 13 Ländern |
| Wettkampfphase | 17. September: Qualifikation 18. September: Finale |
| Medaillengewinner | |
| Igor Ter-Owanessjan ( | |
| Lynn Davies ( | |
| Tõnu Lepik ( | |

In diesem Wettbewerb gewannen die Weitspringer aus der Sowjetunion mit Gold und Bronze zwei Medaillen. Europameister wurde der Sieger von 1958 und 1962 sowie EM-Zweite von 1966 Igor Ter-Owanessjan – außerdem zweifacher Olympiadritter (1960/1964). Er gewann vor dem britischen Titelverteidiger und Olympiasieger von 1964 Lynn Davies. Bronze ging an Tõnu Lepik.
Rekorde
BearbeitenBestehende Rekorde
Bearbeiten| Weltrekord | 8,90 m | Bob Beamon | OS Mexiko-Stadt, Mexiko | 18. Oktober 1968[1] |
| Europarekord | 8,35 m | Igor Ter-Owanessjan | Mexiko-Stadt, Mexiko | 18. Oktober 1967[2] |
| Meisterschaftsrekord | 7,98 m | Lynn Davies | EM Budapest, Ungarn | 31. August 1966 |
Rekordverbesserung
BearbeitenIm Finale waren eine ganze Reihe von Sprüngen zu verzeichnen, die über dem bestehenden Meisterschaftsrekord lagen. Der Rückenwind betrug allerdings bei den meisten dieser Versuche mehr als 2,0 m/s, sodass viele Weiten nicht bestenlistenreif waren. Anerkennungsfähig war das Resultat des sechstplatzierten Max Klauß aus der DDR, der somit den EM-Rekord im Finale am 18. September 1969 um zwei Zentimeter auf 8,00 m verbesserte. Zum Europarekord fehlten ihm 35, zum Weltrekord neunzig Zentimeter.
Qualifikation
Bearbeiten- 17. September 1969, 10.00 Uhr
25 Teilnehmer traten zu einer Qualifikationsrunde in zwei Gruppen an. Vier Athleten (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 7,65 m. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den nächsten bestplatzierten Sportlern auf eigentlich zwölf Springer aufgefüllt. Da es ab Rang elf drei Athleten mit identischer Weite gab, wurden schließlich neun weitere Teilnehmer (hellgrün unterlegt), also insgesamt dreizehn Sportler, für das Finale am darauffolgenden Tag zugelassen. Die Regel der Platzierung über den jeweils besseren zweitbesten Versuch kam in der Qualifikation bezüglich der Auswahl für das Finale auf den Rängen elf bis dreizehn nicht zur Anwendung. 7,65 m reichten letztlich für die Finalteilnahme.
Bei einigen Athleten ist bekannt, zu welcher Qualifikationsgruppe sie gehörten, bei anderen nicht. Deshalb stellt die Tabelle unten eine Gesamtübersicht des Resultats aus beiden Gruppen dar.
| Platz | Name | Nation | Gruppe | 1. Versuch (m) | 2. Versuch (m) | 3. Versuch (m) | Bestweite (m) |
| 1 | Igor Ter-Owanessjan | Sowjetunion | B | 7,56 | 7,87 | – | 7,87 |
| 2 | Klaus Beer | DDR | B | 7,82 | – | – | 7,82 |
| 3 | Leonid Barkowskyj | Sowjetunion | B | 7,79 | – | – | 7,79 |
| 4 | Vasile Sărucan | Rumänien | k. A. | k. A. | 7,66 | ||
| 5 | Lynn Davies | Großbritannien | B | 7,64 | k. A. | 7,64 | |
| 6 | Christian Tourret | Frankreich | B | k. A. | 7,58 | ||
| 7 | Gérard Ugolini | Frankreich | A | x | 7,32 | 7,57 | 7,57 |
| 8 | Jack Pani | Frankreich | A | x | k. A. | 7,56 | |
| 9 | Tõnu Lepik | Sowjetunion | A | k. A. | 7,54 | ||
| 10 | Max Klauß | DDR | A | k. A. | 7,53 | ||
| 11 | Terje Haugland | Norwegen | B | k. A. | 7,35 | ||
| 12 | Jesper Tørring | Dänemark | A | k. A. | 7,35 | ||
| 13 | Nenad Stekić | Jugoslawien | B | k. A. | 7,35 | ||
| 14 | Zdzisław Kokot | Polen | A | k. A. | 7,30 | ||
| 15 | Stanisław Cabaj | Polen | k. A. | k. A. | 7,27 | ||
| 16 | Finn Bendixen | Norwegen | k. A. | k. A. | 7,27 | ||
| 17 | Hannu Kyösola | Finnland | k. A. | k. A. | 7,24 | ||
| 18 | Mihail Zaharia | Rumänien | A | k. A. | 7,23 | ||
| 19 | Waldemar Stępień | Polen | A | x | k. A. | 7,23 | |
| 20 | Rafael Blanquer | Spanien | k. A. | x | 7,22 | 7,06 | 7,22 |
| 21 | Alan Lerwill | Großbritannien | k. A. | k. A. | 7,20 | ||
| 22 | Miljenko Rak | Jugoslawien | k. A. | k. A. | 7,15 | ||
| 23 | Lars-Olof Höök | Schweden | k. A. | k. A. | 7,13 | ||
| 24 | Philippe Houssiaux | Frankreich | k. A. | k. A. | 7,07 | ||
| 25 | Pertti Pousi | Finnland | k. A. | x | x | 6,81 | 6,81 |
Finale
Bearbeiten- 18. September 1969, 16.30 Uhr
| Platz | Name | Nation | Weite (m) | Wind (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Ter-Owanessjan | Sowjetunion | 8,17 w | +4,4 |
| 2 | Lynn Davies | Großbritannien | 8,07 w | +2,2 |
| 3 | Tõnu Lepik | Sowjetunion | 8,04 w | +4,2 |
| 4 | Klaus Beer | DDR | 8,03 w | +3,2 |
| 5 | Leonid Barkowskyj | Sowjetunion | 8,02 w | +2,4 |
| 6 | Max Klauß | DDR | 8,00 CR | +0,8 |
| 7 | Jack Pani | Frankreich | 7,87 w | +2,6 |
| 8 | Gérard Ugolini | Frankreich | 7,87 | +0,8 |
| 9 | Christian Tourret | Frankreich | 7,82 w | +3,0 |
| 10 | Nenad Stekić | Jugoslawien | 7,78 w | +2,3 |
| 11 | Terje Haugland | Norwegen | 7,58 w | +2,8 |
| 12 | Jesper Tørring | Dänemark | 7,41 | +1,8 |
| 13 | Vasile Sărucan | Rumänien | 7,34 | +1,2 |
-
Titelverteidiger Lynn Davies – unter anderem auch Olympiasieger 1964 – gewann diesmal Silber
-
Der Olympiazweite von 1968 Klaus Beer kam auf den vierten Platz
-
Max Klauß belegte Rang sechs und erzielte dabei einen neuen Meisterschaftsrekord – alle weiteren Sprünge waren zu stark windbegünstigt
Weblinks
Bearbeiten- Athina European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 22. Juli 2022
- 9th European Championships Zürich 2014 – Statistics Handbook, European Championship 1969 ATHINA 16th-20th September 1969, Men Long jump, slidelegend.com (englisch), S. 407 (PDF, 13.623 kB), abgerufen am 22. Juli 2022
- IX European Championships 1969 Athens (GRE) Men Long Jump, todor66.com, abgerufen am 22. Juli 2022
- Track and Field Statistics, EM 1969, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 22. Juli 2022
- 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland, ifosta.de, abgerufen am 22. Juli 2022
Videolinks
Bearbeiten- EUROPEAN ATHLETICS 1969 ATHENS LONG JUMP TER OVANESIAN, youtube.com, abgerufen am 22. Juli 2022
- European Athletics Finals (1969), Bereich: 0:23 min bis 0:25 min, youtube.com, abgerufen am 22. Juli 2022
Einzelnachweise und Anmerkungen
Bearbeiten- ↑ Athletics – Progression of outdoor world records, Long jump – Men, sport-record.de (englisch), abgerufen am 22. Juli 2022
- ↑ Athletics - Progression of outdoor European records, Long jump - Men, sport-record.de (englisch), abgerufen am 10. November 2022